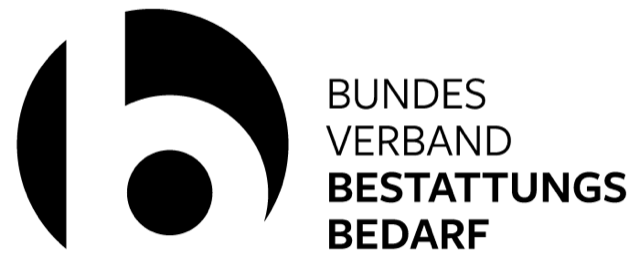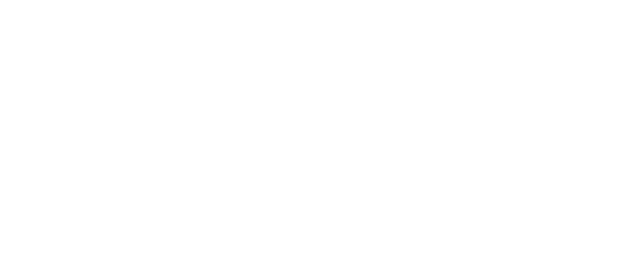Nach ihrem Studium der Psychologie arbeitete Angélique Mundt lange in der Psychiatrie, bevor sie sich 2005 als Psychotherapeutin mit einer eigenen Praxis in Hamburg selbstständig machte. Sie arbeitet seit 2009 ehrenamtlich im Team der DRK-Krisenintervention und leistet dort „Erste Hilfe für die Seele“. Mit diesem Titel erschien 2016 ihr erstes Sachbuch. Um belastende Ereignisse zu verarbeiten, begann Angélique Mundt, ihre Gedanken und Gefühle aufzuschreiben und eine Krimiserie zu entwerfen.
Sie gehen dorthin, wo andere Leute am liebsten wegrennen würden – zu den Familien von Todesopfern. Wie gehen Menschen mit einer Todesnachricht um?
Wenn die Polizei zur Überbringung einer Todesnachricht an der Tür klingelt, wissen die meisten Menschen, dass etwas passiert sein muss. Erst recht, wenn wir mitten in der Nach kommen. Viele schauen die Polizisten an, schlagen die Hand vor den Mund, reißen die Augen auf und wissen, dass ihrem Mann, ihrer Frau oder ihrem Kind etwas zugestoßen ist. Sind die Worte erst einmal ausgesprochen, „Ihr Kind ist tot, es starb bei einem Verkehrsunfall“, gibt es kein zurück mehr. Dann kann alles passieren. Menschen reagieren verzweifelt, weinen, schreien. Andere sind ungläubig: ‚Mein Sohn ist doch auf dem Weg zur Schule, er ist nicht tot!‘ Manche werden hektisch, lehnen die Nachricht ab, werden aggressiv. Es gibt Menschen, die regelrecht erstarren, die die Nachricht nicht aufnehmen können, bis hin zu paradoxen Reaktionen: ‚Das ist ja interessant, ich bin aber gerade beim Fensterputzen, vielleicht könnten Sie später noch einmal wiederkommen.‘ Das ist eine Schutzreaktion: Was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Wichtig ist: Alle diese Reaktionen sind normal – in einer unnormalen Situation.
Was können Sie tun? Können Sie überhaupt etwas tun?
Wir versuchen, in welcher Situation auch immer, für die Menschen da zu sein. Wir haben Zeit. An einem Unfallort beispielsweise ist es wichtig, die Menschen an einen geschützten Ort zu bringen, außerhalb der Sichtweite des Unfallorts, in eine Umgebung, in der sie das Geschehene ansatzweise verstehen können. Wir kümmern uns etwa um die Mutter während ihr Kind reanimiert wird, geben wichtige Informationen, erklären, was gerade passiert und später geschehen wird. Um Informationen dann zu geben, wenn sie relevant werden und die Betroffenen nicht zu überfordern, sind Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt. Manchmal sitze ich auch einfach nur mit den Menschen zusammen und halte das Schweigen oder Weinen gemeinsam mit ihnen aus, bevor die ersten Worte fallen. Vor einem Einsatz weiß ich nie, was oder wer mich erwartet, also auch nicht, ob ich zwei oder 12 Stunden lang gebraucht werde.
Wir aktivieren das soziale Netz der Betroffenen, auch für Kinder, für die ihre Freunde in einem solchen Moment besonders wichtig sind. Ich gehe erst, wenn für die betroffenen Familien klar ist, wie es weitergeht, wenn sie wissen, wer ihnen hilft. Im Sinne einer Brückenfunktion vermitteln wir vielleicht einen Anwalt, einen Bestatter, einen Traumatherapeuten, einen Übersetzer oder überlegen, welche Institution mit Geld weiterhelfen kann, wenn jemand vielleicht keine Krankenversicherung hat. Bei Tötungsdelikten alarmiere ich auch mal einen Tatortreiniger mitten in der Nacht, wenn die Familien in die Wohnung zurückmüssen, weil sie keine andere Bleibe haben. Für die weitere Betreuung gibt es Opferschutzorganisationen wie den Weißen Ring oder Vereine wie Verwaiste Eltern. Wir suchen die richtige Institution für die Bedürfnisse der betroffenen Familien. Wir sind alle sehr eng vernetzt.
Wie erklären Sie Kindern den Tod?
Kinder reagieren etwas anders als Erwachsene: Je nach Alter haben Kinder noch keinen erwachsenen Todesbegriff. Vielleicht gibt es bereits die Erfahrung, dass die Oma gestorben und nicht wiedergekommen ist. Doch die Bedeutung des Wortes ‚Tod‘ geht mit dem Unendlichkeitsbegriff einher, den Kinder erst mit dem 10. oder 11. Lebensjahr entwickeln. Darum reagieren kleine Kinder auch nicht ängstlich auf den Tod. Sie weinen, weil andere Kinder oder Menschen weinen, aus Empathie. Sie haben eher Trennungsängste und wollen dicht bei den Eltern bleiben. Ich musste einmal eine Todesnachricht an zwei kleine Kinder in der Kita überbringen. Der Vater hatte die Mutter umgebracht und war inhaftiert worden. Das fünfjährige Mädchen wusste sofort: Mama ist nicht gekommen, irgendetwas ist anders. Mich hat das Kind erst einmal ignoriert, bis ich mich ihrem Tempo angepasst, mich im Wechselspiel mit ihr verständigt und ihr gesagt habe, dass die Mama gestorben ist und dass sich erst einmal eine liebe Pflegefamilie um sie und ihre kleine Schwester kümmert, da der Papa von der Polizei befragt wird. Sie hat viel später an dem Abend gefragt, ob Papa der Mama das angetan hat? So klein sie war, hat sie trotzdem verstanden, dass beide Eltern nicht zurückkommen.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Bestattern?
Wir dürfen keine konkreten Bestatter empfehlen, sondern fragen z.B. beim häuslichen Tod die Angehörigen nach ihren Erfahrungen oder ob ihnen vielleicht ein Institut in der Nachbarschaft einfällt, das wir anrufen könnten. Wenn es soweit ist, möchten manche dabei sein, wenn der Bestatter den Verstorbenen auf die Bare legt, andere können sich das gar nicht vorstellen oder wollen den Verstorbenen gerne bei sich behalten. Eine Frau wollte ihr Kind nach einem plötzlichen Kindstod nicht dem Bestatter übergeben. Ich habe nach einer Zeit gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich das Kind übergebe. Die Bestatter, die ich erlebe, sind sehr einfühlsam, geduldig und kooperativ. Manchmal ist es aber auch nicht möglich, dass die Angehörigen den oder die Verstorbene sehen, z.B. bei Feuer- und Wasserleichen. Das bespreche ich mit dem Bestatter, die mir ausreichend Zeit lassen, mit den Angehörigen zu sprechen und viel Verständnis zeigen. Gleiches gilt für die Bestattung, von der ich oft höre, dass Bestattungsrituale gewählt wurden, die die Betroffenen brauchen. Die Arbeit des Bestatters und ihr Kontakt zu den Angehörigen wird meiner Ansicht nach oft unterschätzt. Sie machen einen guten und wichtigen Job. Sie helfen, mit dem Tod umzugehen.
Welche Rolle haben Sie bei der Abschiednahme vom Verstorbenen?
Wir führen im KIT nur Notabschiednahmen durch. Das heißt, wir bringen die Angehörigen unmittelbar nach dem Versterben zu dem Toten. Ins Krankenhaus oder das Institut für Rechtsmedizin. Den wesentlichen Part haben die Bestatter, denn viele Angehörige wollen sich nicht sofort verabschieden. In diesen Fällen weise ich darauf hin, dass sie auch gerne einige Tage später im Bestattungsinstitut Abschied nehmen können, vor allem, wenn weitere Angehörige anreisen müssen. Dann geht es ums buchstäbliche Begreifen des Todes. Selbst Angehörige, die dies bereits kognitiv wissen, brauchen für die emotionale Verarbeitung das Bild des Verstorbenen und müssen ihn anfassen, um zu sehen: Ja, er ist kalt, er riecht anders, er antwortet nicht, er ist tot. Begleite ich eine Abschiednahme im Institut für Rechtsmedizin, schaue ich mir den Verstorbenen immer erst mal selber ohne den Angehörigen an, um sie und mich auf den Anblick vorbereiten zu können. Auch von schwer verletzten Menschen empfehlen wir Abschied zu nehmen, selbst wenn sie nicht hergerichtet sind oder nur noch Hände oder Füße erhalten sind. Vor allem eine Hand ist so individuell, das Handhalten so elementar, dass man sich durchaus von ihr verabschieden kann. Darum finde ich es auch bei Unfallopfern wichtig, dass die Hände auf der Decke liegen, wenn sie nicht zu stark verletzt sind. ‚Behalten Sie Ihren Mann so in Erinnerung, wie Sie ihn kannten‘ ist aus psychologischer Sicht falsch. Seine Frau kannte ihn nur lebend. Um den Tod zu verstehen, braucht man gegebenenfalls das eine Bild des Toten. Dieses Bild überschreibt nicht die tausenden von Erinnerungen an den lebenden Mann. Ich habe ohnehin die Erfahrung gemacht, dass die Angehörigen viel mehr mit ihren Herzen, als mit den Augen sehen. Einmal habe ich dem Rechtsmediziner nach einem Tötungsdelikt, bei dem das Opfer schwer massakriert wurde, geholfen, die Schnitte im Gesicht mit Pflastern abzudecken. Das sah schlimm aus, doch die Eltern haben das Haar gestreichelt, das intakte Ohr, die Nase und erkannten ihre Tochter.
Wie planen Sie ihr „normales“ Leben um diese Einsätze herum?
Wir arbeiten ehrenamtlich in Hamburg mit 40 Mitarbeitern, die mindestens zwei Mal im Monat 24 Stunden Bereitschaft haben. Wenn das Telefon klingelt, muss ich sofort los. Meine psychotherapeutische Praxis bleibt an den Tagen geschlossen. Ich nutze die Bereitschaft für Büroarbeit, bis es losgeht. Dann bin ich für viele Stunden gebunden. Kommt in dieser Zeit ein zweiter Einsatz, dann muss man sich aufteilen oder den Hintergrunddienst informieren, um zwei neue Kollegen zum Einsatz zu schicken, denn wir fahren in der Regel zu zweit in einen Einsatz. Kollegen bleiben im Durchschnitt drei bis fünf Jahre im KIT und hören dann auf, weil der Beruf oder das Leben sich ändert. Wir müssen also alle zwei Jahre dafür sorgen, dass 10 bis 15 neue Kollegen dazukommen. Es ist ein sehr anspruchsvolles Ehrenamt. Dass jemand zehn Jahre dabei bleibt, ist selten.
Was hat sich durch das Ehrenamt in Ihrem Leben verändert?
Seit ich als Teil des KIT ständig erlebe, wie plötzlich und unerwartet der Tod alles verändern kann, hat sich auch mein Leben gewandelt. Ich bin demütiger geworden und gehe bewusster mit meinem Leben um. Ich mache seitdem viel mehr Dinge, weil ich sie tun will, nicht, weil ich sie tun sollte oder muss. Ich habe gelernt ‚Nein‘ zu sagen. Und ich umgebe mich möglichst mit Menschen, die meine Zeit erfüllen, nicht verschwenden. Ich sorge für mein Leben und bin für Freunde und Familie da, habe erfüllende Hobbys. Da ich in meiner Psychotherapeutischen Praxis Menschen behandele, die einen schweren Schaden genommen haben, weil ihnen in einer Krisensituation nicht rechtzeitig geholfen wurde, war meine Motivation, etwas zu tun, damit sie gar nicht erst krank werden und ihre Krise aus eigener Kraft überstehen.
Was sollte sich generell in der Gesellschaft ändern, wenn es um den Tod geht?
Im Sinne eines gesunden Umgangs mit dem Tod empfehle ich allen Menschen, schwierigen Situationen nicht auszuweichen, sondern sie zu nutzen, um gewissermaßen für Extremsituationen zu trainieren. Mein Anliegen ist, es nicht totzuschweigen, wenn jemand gestorben ist. Viele vermeiden den Kontakt zu Trauernden aus Hilflosigkeit. Dabei müssen, ja können sie nicht viel tun, außer sich hinzusetzen und beispielsweise zu sagen: ‚Ich habe gehört, was dir passiert ist. Ich habe keine Worte‘ oder auch einfach ‚Schön, dass du wieder da bist‘. Trauernde fühlen sich ausgeschlossen. Meist hilft es, sie wieder in den Alltag einzubeziehen. Oft können Betroffene sehr gut sagen, was sie brauchen, auch wenn sie nicht reden wollen. Wichtig ist das Signal: Ich bin da. Man kann wenig falsch machen, solange man etwas versucht. Und selbst dann kann man zurückziehen und etwas anderes probieren. Nur die Trauernden auszugrenzen ist grundsätzlich falsch. Selbst ich habe nach zehn Jahren KIT noch keine ‚richtigen‘ Worte. Aber ich habe die Gewissheit, dass ich versuchen werde, die Situation gemeinsam mit dem Betroffenen auszuhalten. Das ist schon hilfreich.
Sie sind auch Krimiautorin. Was gibt Ihnen das Schreiben?
Das Schreiben ist etwas sehr Individuelles mit meiner ganz eigenen Logik. Ich bin den ganzen Tag mit intensiven Emotionen beschäftigt. Die Menschen kommen zu mir, weil sie Sorgen und Nöte haben, nicht, weil es Ihnen gut geht. Ich erlebe die schwärzesten Stunden ihres Lebens. Als Psychotherapeutin bin ich geübt darin, auf meine eigenen Gefühle zu schauen, gut für mich zu sorgen und habe Erfahrung darin, was ich mir gut tut. Dabei habe ich festgestellt, dass mir das Schreiben hilft. Das kann auch ein Einsatzbericht sein, um mich und meine Gedanken und Gefühle zu sortieren. Dabei notiere ich oft separat ein paar Dinge, die am Rande der Katastrophe passiert sind, die mich berührt haben. So lagen bei einem Verkehrsunfall mit vier Toten Fußgängern, Einkaufstüten und Handtaschen mitten zwischen den Toten. Äpfel rollten über den Bürgersteig. Stumme Zeugen der Panik, die noch vor kurzer Zeit an diesem Ort geherrscht haben muss. Wenn ich nach Worten für etwas Emotionales suche, distanziere ich mich von diesem Gefühl. In meinen Kriminalromanen interessieren mich weniger die Mörder oder Täter, sondern die überlebenden Opfer. Was passiert mit ihnen nach einem Mord? Was richtet die Tat im Umfeld an? In einem meiner Bücher verwische ich die Grenzen zwischen gesund und krank: Da sind vielleicht Zwangsgedanken schlimmer als die Realität. Da ist unklar, ob Wahn Wirklichkeit ist?